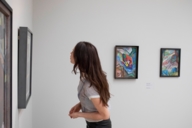
Unsere Autorin ist eine moderne junge Frau. Was hat Jawlenskys „Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff“ ihr zu sagen?
Weiß geschminkte Menschen machen mir Angst. Mein Vater hat meine drei Geschwister und mich ziemlich früh Erwachsenenfilme mit ansehen lassen. Klassiker: „Der weiße Hai“, „Friedhof der Kuscheltiere“, „ES“. Ich war damals sechs oder sieben Jahre alt. Zu seiner Verteidigung: Wahrscheinlich wollte er uns möglichst schnell und schmerzvoll mental fürs Leben rüsten. Vielleicht nahm er den Plastikhai von Universal und mit Blut gefüllte Luftballons aber auch einfach nicht so ernst.
Ich bin jedenfalls jahrelang nicht mal in Baggerseen gesprungen und ich hasse Clowns und jede weiß übertünchte Mimik. Man kann ihr nicht trauen. Ich denke an Pennywise mit den Reißzähnen und an den Joker und an all die Pantomimen der Innenstädte, die unsichtbare Bananen schälen. Und trotzdem sitze ich jetzt hier im Kunstbau des Lenbachhauses und starre auf das weiß geschminkte Gesicht des russischen Tänzers Alexander Sacharoff.
Es ist plakativ, es ist auffällig, es ist der Traum jedes Werbeprofis, denn die Werbung liebt Komplementärfarben: je krasser der Kontrast, desto größer die Aufmerksamkeit.
Um dieses Gemälde von Alexej von Jawlensky kommt man im und ums Lenbachhaus kaum herum. Auf Plakaten, Magneten, Postkarten, Kalendern, überall sticht es einem sofort ins Auge. Rot auf Türkisblau. Es ist plakativ, es ist auffällig, es ist der Traum jedes Werbeprofis, denn die Werbung liebt Komplementärfarben: je krasser der Kontrast, desto größer die Aufmerksamkeit. Das Thema wurde in der Schule ewig durchgekaut. Mein Kunstlehrer Herr Mayer hatte eine sehr große behaarte Warze auf der Nase. Und genauso, wie ich diese Warze zu ignorieren versucht habe, habe ich bisher kategorisch Blickkontakt mit Sacharoff vermieden.
Ich weiß, dass Sacharoff auf Jawlenskys Porträt keinen Clown darstellt. Er ist in der Art japanischer Kabuki-Schauspieler*innen geschminkt. Viele beschreiben seinen Blick als verführerisch, anziehend. Mir ist er nicht geheuer. Sacharoffs Augen, sie glühen gelblich, bösartig. Sein Lächeln: falsch. Verschlagen. Und diese aufgesetzte Rose – als habe jemand sie dem Tänzer durch sein blutrotes Kleid hindurch mitten ins Herz gestoßen. Ich muss mich beruhigen. Vor mir hängt keine tiefenpsychologische Rorschachtafel, sondern ein Meisterwerk.
Selbstverständlich habe ich mich auf Alexander Sacharoff vorbereitet. Starren gilt ja allgemein als unhöflich, vor einem Kunstwerk ist es zwar üblich, mir ist trotzdem wohler, wenn ich mein Gegenüber ein wenig kenne. Wie Sacharoff kamen um die Jahrhundertwende viele russische Künstler*innen nach München, ein Anlaufpunkt war die Schwabinger Wohnung der russischen Maler Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin.
Die Ausstellung „Lebensmenschen“, in der ich mich gerade befinde, widmet sich dem avantgardistischen Künstlerpaar. Der 21-jährige Sacharoff tauchte Anfang 1908 zum ersten Mal in dessen Salon auf und wurde sein engster Freund. Beide malten ihren Freund. Vor mir hängt das Bild von Jawlensky; mir im Nacken eines von Werefkin, Sacharoff im Geisha-Kostüm. Sein Haar ist darauf brav frisiert, und kein dicker kohlrabenschwarzer Lidstrich umschattet seine Augen, aber ich sag’s ganz ehrlich: Es wirkt auf mich mindestens genauso diabolisch. Seine Iris ist orange!
Geschlechterrollen löste er in seiner androgynen Erscheinung auf. Genau diese Androgynität inspirierte viele Künstler seines Kreises. Kein Tänzer wurde so oft gemalt wie Sacharoff.
Beide Bilder entstanden 1909. Sacharoff trat in dem Jahr als einziger Tänzer der „Neuen Künstlervereinigung München“ bei, aus der sich später Der Blaue Reiter gründete. Damals trat er privat in der Schwabinger Szene auf und bereitete sich auf sein offizielles Debüt im Münchner Odeon vor. Eines Tages besuchte er Jawlensky im Atelier, und der griff spontan zum Pinsel. Links neben mir hört gerade eine Dame auf ihrem Audioguide die Nummer 417 zum Sacharoff-Porträt und schreit ihrem Mann hinterher: „In ana halben Stund’ war des g’malt!“ War es. Und damit Jawlensky nichts mehr daran ändern konnte, nahm Sacharoff die noch feuchte Malpappe sofort an sich. Deshalb erscheint das Porträtbild so unmittelbar und präsent. Die Pinselstriche sind lebendig, unregelmäßig, der Malgrund ist deutlich zu sehen. Zwanghafte Perfektionist*innen würden das Bild sicher gern ausmalen.
Erstaunlicherweise sind die markante Nase und das ungewöhnlich schmale Gesicht mit dem spitz zulaufenden Kinn nicht überzeichnet. Auf einem Gruppenbild der Freunde im Ausstellungskatalog zeigt Sacharoff fast genau dieses Gesicht, trägt allerdings einen klassischen schwarzen Anzug – was ungewöhnlich für ihn war, denn dieser Mann war ein Paradiesvogel, auf und jenseits der Bühne eine Erscheinung, häufig in Frauenkleidern. Sacharoff war keine moderne Dragqueen wie Olivia Jones oder RuPaul, kein Travestiekünstler wie Conchita Wurst. Er konnte sich zwar ausgezeichnet schminken und entwarf seine fantastischen Kostüme selbst. Seine Kunst war aber nicht gesellschaftspolitisch motiviert.
Das spießige München wusste Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesem geschlechtslosen Wesen nicht so recht umzugehen. Man ging noch vorzugsweise ins Theater, um Balletttänzer Pirouetten drehen zu sehen.
Sacharoffs Selbstverständnis dürfte vielen Menschen heute fremd sein: Er tanzte nicht, um dafür gefeiert zu werden. Er wollte nicht einmal ein großes Publikum. Er tanzte allein um der Kunst willen, wollte wie Poesie leise und still genossen werden. Geschlechterrollen löste er in seiner androgynen Erscheinung auf. Genau diese Androgynität inspirierte viele Künstler*innen seines Kreises. Kein*e Tänzer*in wurde so oft gemalt wie Sacharoff. Alexej von Jawlensky porträtierte ihn mehrmals kostümiert und geschminkt: als Spanierin, mit roten Lippen, mit weißer Feder im Haar. In vieler Hinsicht war Sacharoffs Kunst fortschrittlich und richtungsweisend.
Als Sacharoff 1905 nach München kam, um sich zum Tänzer ausbilden zu lassen, nahm er zuerst Unterricht in klassischem Ballett. Er lernte aber auch Akrobatik im Schumann-Zirkus (da sind sie wieder, die Clowns). Er ließ japanische, griechische und ägyptische Elemente in seine Tanzsprache einfließen. Er brach das Handgelenk – knickte es ab –, was im klassischen Ballett verboten ist. Ich weiß das genau, weil ich als Kind fünf Jahre lang im Ballett war und genau das falsch gemacht habe. Es gibt Fotos davon.
Sacharoff beging diesen Bruch bewusst. Im Bruch entsteht Neues: Er schuf eine eigene Form des modernen Tanzes, die „abstrakte Pantomime“. Ein Bruch kann aber auch spalten. Publikum und Presse waren gespalten; entweder begeistert oder bestürzt, verunsichert, verärgert. Das spießige München wusste Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesem geschlechtslosen Wesen nicht so recht umzugehen. Man ging noch vorzugsweise ins Theater, um Balletttänzer*innen Pirouetten drehen zu sehen. Plötzlich führte ein Mann in exotischen Frauenkleidern, allein, ohne Ensemble, einen von Pose zu Pose präzise durchkomponierten Schreittanz auf. Schade, dass von Sacharoffs Tänzen keine Filmaufnahmen existieren, nur flüchtige Studienskizzen, die Tanzschulen heute wie Daumenkinos nachzuvollziehen versuchen.
Ich habe mir ein paar Kritiken von damals durchgelesen. Der deutsche Schriftsteller Friedrich Markus Huebner schrieb 1914 in der „Monatsschrift für Ästhetik und Kritik des Theaters“: „Sacharoff verwirrt. Er verwirrt uns Heutige. Der antike Mensch hätte das Panische der Erotik in seinem Tanzausdruck wahrscheinlich mit wissendem Kopfnicken gegrüßt. Heute ist dieses Wissen erstickt.“ Ich mag an Sacharoff, dass er andere irremachte. Ich mag irre Menschen, Menschen, die anders, eigen sind. Solche Menschen müssen meistens mutig sein, weil sie anecken. Bei Sacharoff gipfelte es darin, dass er zu Kriegsbeginn 1914 als „feindlicher Ausländer“ Deutschland verlassen musste, die Porträts von ihm galten als „entartet“.
Es ist jetzt eine gute halbe Stunde vergangen, und Sacharoffs Lächeln erscheint mir nicht mehr fies. Eher herausfordernd und unerschrocken. Es sagt: „Ja, ja, mir ist scheißegal, was ihr von mir denkt.“ Was für ein cooler Typ.
Ich frage mich, wie die Menschen heute auf Sacharoffs Kunst reagieren würden. Wir sind ja leider oft nicht gar so aufgeschlossen, wie wir gerne glauben und andere glauben machen wollen. Wie die Menschen auf Sacharoff als Muse und Bildmotiv reagieren, erlebe ich live mit. Die Irritation ist nicht verklungen. „Des könnt jetzt auch a Frau sein“, sagt ein älterer Mann mit kurzen grauen Haaren und Brille, der seiner Frau mit den kurzen grauen Haaren und der Brille signifikant ähnlich sieht. „Ja, ja“, sagt sie. Wir wissen alle, was „ja, ja“ heißt. Es ist jetzt eine gute halbe Stunde vergangen, und Sacharoffs Lächeln erscheint mir nicht mehr fies. Eher herausfordernd und unerschrocken. Es sagt: „Ja, ja, mir ist scheißegal, was ihr von mir denkt.“ Was für ein cooler Typ.
Pauline Krätzig hat kein Problem mit Männern in Frauenkleidern: Ihr älterer Bruder hat sich schon mehrmals als Frank N. Furter aus der „Rocky Horror Picture Show“ verkleidet. Ihr Vater als Badenixe.